Chinesische Betrachtungsweise von Mensch, Gesundheit und Krankheit
Das medizinisch-wissenschaftliche Denksystem der Chinesen, welches keinesfalls getrennnt von der chinesischen Philosophie verstanden werden kann, unterscheidet sich grundsätzlich von unserer westlichen Betrachtungsweise von Mensch, Gesundheit und Krankheit. Im Folgenden wird versucht, in äusserst knapper Form die wichtigsten konzeptionellen Unterschiede darzulegen:
Der westlichen Medizin liegt ein kausal-analytischer Erkenntnismodus zu Grunde:
Im Mittelpunkt steht nicht nur das Befinden des Menschen, sondern die Bemühungen sind häufig darauf ausgerichtet, physikalisch chemisch messbare Befunde zu erheben. Eine Diagnose zielt meistens darauf ab, aufgrund von solchen Befunden die Ursache eines gestörten Befindens festzustellen. Es ist das Ziel, Krankheiten aufgrund pathophysiologisch materiell nachweisbarer und messbarer Veränderungen einzugrenzen und zu charakterisieren. So erlaubt es beispielsweise die Messung des Verlaufs von myokardinfarktspezifischen Enzymen im Serum bei entsprechender Klinik die Diagnose eines Myokardinfarkts zu stellen. Oder die Diagnose Magenkarzinom wird beispielsweise häufig aufgrund bioptisch nachgewiesener Karzinomzellen gestellt.
Die westliche Medizin bildet hiermit vorwiegend eine organbezogene, somatische Medizin. Eine Therapie besteht idealerweise darin, die krankmachenden Ursachen nach Möglichkeit auszuschalten.
Die chinesische Medizin dagegen gründet auf einem induktiv-synthetischen Erkenntnismodus.
 Die Chinesen betrachten den Menschen als ein Aktivität enthaltendes, kosmisches Wirkgefüge.
Alle gleichzeitig vorhandenen aktiven Lebensäusserungen, Funktionen und Bewegungen des Menschen sind von zentraler Bedeutung. Materielle, stoffliche, messbare Aspekte treten in den Hintergrund. Daher ist es nicht Ziel der chinesischen Diagnostik, organische, messbare Veränderungen als Ursache eines bestimmten Krankheitszustandes festzustellen. Es wird hingegen versucht, alle aktiven Lebensäusserungen eines Menschen wie zum Beispiel Emotionen, Bedürfnis nach Ruhe, Bedürfnis nach kalten Getränken, Geschwätzigkeit oder Wortkargheit etc., zu einem Ganzen zusammenzufügen. Dieses Gesamtbild der aktiven Äusserungen eines Lebewesen wird rational und schlüssig einem Entsprechungssystem zugeordnet, um damit zu einer chinesischen Diagnose zu kommen.
Die Chinesen betrachten den Menschen als ein Aktivität enthaltendes, kosmisches Wirkgefüge.
Alle gleichzeitig vorhandenen aktiven Lebensäusserungen, Funktionen und Bewegungen des Menschen sind von zentraler Bedeutung. Materielle, stoffliche, messbare Aspekte treten in den Hintergrund. Daher ist es nicht Ziel der chinesischen Diagnostik, organische, messbare Veränderungen als Ursache eines bestimmten Krankheitszustandes festzustellen. Es wird hingegen versucht, alle aktiven Lebensäusserungen eines Menschen wie zum Beispiel Emotionen, Bedürfnis nach Ruhe, Bedürfnis nach kalten Getränken, Geschwätzigkeit oder Wortkargheit etc., zu einem Ganzen zusammenzufügen. Dieses Gesamtbild der aktiven Äusserungen eines Lebewesen wird rational und schlüssig einem Entsprechungssystem zugeordnet, um damit zu einer chinesischen Diagnose zu kommen.
Der wichtigste und zugleich bekannteste Teil dieses komplexen Entsprechungssystems bildet das polare Kräftepaar Yin und Yang. Dieses wird in der chinesischen Denkweise nicht nur in der Medizin, sondern überhaupt zur Qualifikation aller Phänomene der Natur verwendet.
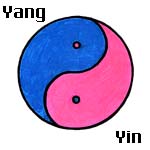 Wie das Fushi-Zeichen (vgl. Abbildung) zum Ausdruck bringt, werden mit Yin und Yang zwei komplementäre Gegensätze oder Polaritäten dargestellt. Diese zwei Polaritäten ergänzen sich als wechselseitig ablösende, qualitativ unterschiedliche Erscheinungsformen harmonisch zu einer Einheit. Dabei ist gleichzeitig das eine im anderen enthalten. Der Yin-Aspekt steht für Stoffliches, Ruhendes, Bewahrendes, Dunkles und Kaltes. Der Yang-Aspekt beschreibt für sich aktiv Entfaltendes, Bewegtes, Extrovertiertes, Helles und Warmes.
Wie das Fushi-Zeichen (vgl. Abbildung) zum Ausdruck bringt, werden mit Yin und Yang zwei komplementäre Gegensätze oder Polaritäten dargestellt. Diese zwei Polaritäten ergänzen sich als wechselseitig ablösende, qualitativ unterschiedliche Erscheinungsformen harmonisch zu einer Einheit. Dabei ist gleichzeitig das eine im anderen enthalten. Der Yin-Aspekt steht für Stoffliches, Ruhendes, Bewahrendes, Dunkles und Kaltes. Der Yang-Aspekt beschreibt für sich aktiv Entfaltendes, Bewegtes, Extrovertiertes, Helles und Warmes.
Durch die Wahrnehmung und Beobachtung nicht quantitativ messbarer, sondern qualitativ beschreibbarer Aspekte des Menschen wird es möglich, mithilfe des ausgebauten Entsprechungssystems dort Diagnosen zu stellen, wo trotz gestörtem subjektivem Befinden eines Patienten keine organisch messbaren Veränderungen vorhanden sind. In solchen Situationen wird in der westlichen Medizin häufig keine eindeutige Diagnose gestellt, sondern etwa von "vegetativer Dystonie" oder von "funktionellen Beschwerden" gesprochen. Umgekehrt ist die chinesische Diagnostik nicht darauf ausgerichtet, somatische, organisch nachweisbare Störungen aufzugreifen. Für die Chinesen bedeutet Krankheit eine nicht quantitativ messbare, sondern qualitativ beschreibbare Beeinträchtigung der Orthopathie. Mit Orthopathie ist die Fähigkeit zur harmonischen Äusserung aller Lebensfunktionen gemeint, die Fähigkeit zum Aufrechterhalten des optimalen Wohlbefindens, der "Gesundheit". Eine Krankheit stellt somit eine qualitative Beeinträchtigung des Funktionsoptimums dar. Die verschiedenen Lebensäusserungen einer gestörten Harmonie von Lebensfunktionen werden mithilfe des ausgebauten, komplexen Entsprechungsssystems qualitativ erfasst.
Die verschiedenen chinesischen Therapieverfahren sind ähnlich einem Schlüssel-Schloss-Prinzip genau auf die verschiedenen, mithilfe dieses Entsprechungssystems qualitativ erfassten Störungen der Orthopathie abgestimmt. Chinesische Therapieverfahren können daher nicht getrennt von der chinesischen Diagnostik betrachtet und angewandt werden. Das Ziel einer chinesischen Therapie ist nicht die Beseitigung der krankheitsauslösenden Ursache. Diese kann oft nur schwer oder gar nicht beseitigt werden (zum Beispiel Luftdruckschwankungen als Auslöser von Migräneanfällen). Ziel einer chinesischen Therapie ist die Wiederherstellung der Ortopathie durch eine möglichst vollkommene Einfügung des Individuums in die Kräfte aller endogenen und exogenen Einflüsse.
Aufgrund der beiden kurz dargestellten, diametral entgegengesetzten Erkenntnismodi und der sich darauf aufbauenden entsprechenden Diagnostik und Therapie konkurrenzieren sich die westliche und chinesische Medizin nicht, sondern sie verhalten sich ausgesprochen komplementär.
 Die Chinesen betrachten den Menschen als ein Aktivität enthaltendes, kosmisches Wirkgefüge.
Alle gleichzeitig vorhandenen aktiven Lebensäusserungen, Funktionen und Bewegungen des Menschen sind von zentraler Bedeutung. Materielle, stoffliche, messbare Aspekte treten in den Hintergrund. Daher ist es nicht Ziel der chinesischen Diagnostik, organische, messbare Veränderungen als Ursache eines bestimmten Krankheitszustandes festzustellen. Es wird hingegen versucht, alle aktiven Lebensäusserungen eines Menschen wie zum Beispiel Emotionen, Bedürfnis nach Ruhe, Bedürfnis nach kalten Getränken, Geschwätzigkeit oder Wortkargheit etc., zu einem Ganzen zusammenzufügen. Dieses Gesamtbild der aktiven Äusserungen eines Lebewesen wird rational und schlüssig einem Entsprechungssystem zugeordnet, um damit zu einer chinesischen Diagnose zu kommen.
Die Chinesen betrachten den Menschen als ein Aktivität enthaltendes, kosmisches Wirkgefüge.
Alle gleichzeitig vorhandenen aktiven Lebensäusserungen, Funktionen und Bewegungen des Menschen sind von zentraler Bedeutung. Materielle, stoffliche, messbare Aspekte treten in den Hintergrund. Daher ist es nicht Ziel der chinesischen Diagnostik, organische, messbare Veränderungen als Ursache eines bestimmten Krankheitszustandes festzustellen. Es wird hingegen versucht, alle aktiven Lebensäusserungen eines Menschen wie zum Beispiel Emotionen, Bedürfnis nach Ruhe, Bedürfnis nach kalten Getränken, Geschwätzigkeit oder Wortkargheit etc., zu einem Ganzen zusammenzufügen. Dieses Gesamtbild der aktiven Äusserungen eines Lebewesen wird rational und schlüssig einem Entsprechungssystem zugeordnet, um damit zu einer chinesischen Diagnose zu kommen.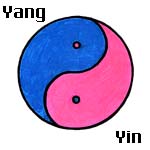 Wie das Fushi-Zeichen (vgl. Abbildung) zum Ausdruck bringt, werden mit Yin und Yang zwei komplementäre Gegensätze oder Polaritäten dargestellt. Diese zwei Polaritäten ergänzen sich als wechselseitig ablösende, qualitativ unterschiedliche Erscheinungsformen harmonisch zu einer Einheit. Dabei ist gleichzeitig das eine im anderen enthalten. Der Yin-Aspekt steht für Stoffliches, Ruhendes, Bewahrendes, Dunkles und Kaltes. Der Yang-Aspekt beschreibt für sich aktiv Entfaltendes, Bewegtes, Extrovertiertes, Helles und Warmes.
Wie das Fushi-Zeichen (vgl. Abbildung) zum Ausdruck bringt, werden mit Yin und Yang zwei komplementäre Gegensätze oder Polaritäten dargestellt. Diese zwei Polaritäten ergänzen sich als wechselseitig ablösende, qualitativ unterschiedliche Erscheinungsformen harmonisch zu einer Einheit. Dabei ist gleichzeitig das eine im anderen enthalten. Der Yin-Aspekt steht für Stoffliches, Ruhendes, Bewahrendes, Dunkles und Kaltes. Der Yang-Aspekt beschreibt für sich aktiv Entfaltendes, Bewegtes, Extrovertiertes, Helles und Warmes.